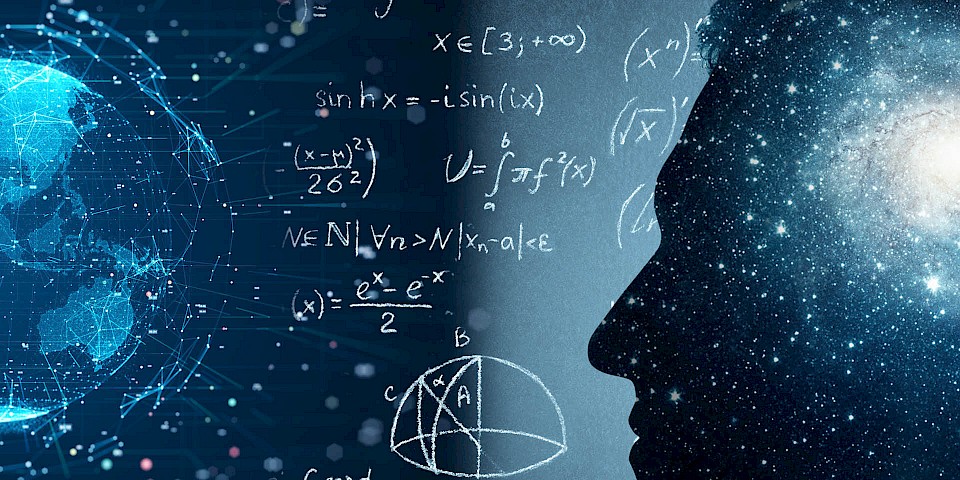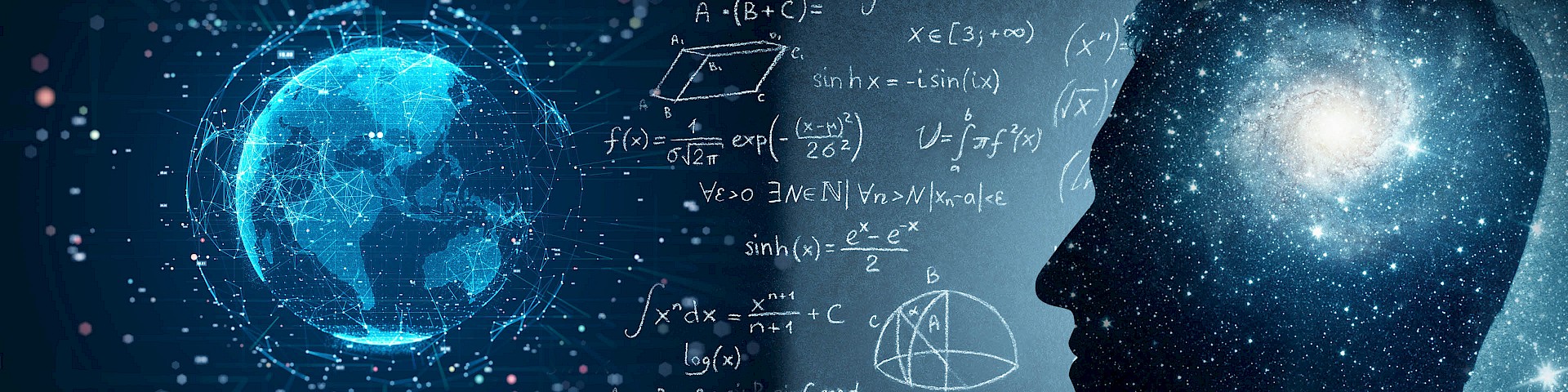Wertfreie Wissenschaften
Das Ideal einer (wert)freien „objektiven“ Wissenschaft und die sich mit der Technisierung in den Vordergrund drängenden Erkenntnisse der Naturwissenschaften prägten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entscheidend das moderne westliche Weltbild. Historisch ableitbar entwickelte sich daraus ein - über weite Strecken des späten 19. und des gesamten 20. Jahrhunderts hinauswirkender - unbegrenzter Fortschrittsoptimismus.
Einer Allmachtsvorstellung naturwissenschaftlich entwickelter Lösungsstrategien gleich ist Wissenschaft jedoch nicht frei von Glaubensvorstellungen und (Vor-)annahmen und (Vor-)urteilen der Forschenden, welche die Art und Weise beeinflussen, wie Forschung betrieben und interpretiert wird und wer letztlich was mit welchem erwarteten Ergebnis finanziert.
Dieser einseitig naturwissenschaftlich geprägte Fortschrittsoptimismus geriet daher in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zunehmend in eine grundlegende Krise. Ursache dafür waren die ökologischen Schäden einer rücksichtslos „wissenschaftlich-technischen Zivilisation“ sowie die schwer abschätzbaren gesellschaftlichen Risiken eines Menschenbildes nach dem Motto „erst mal ich, und dann sehen wir weiter“, das sich in den rein naturwissenschaftlich-technischen Entwicklungen zulasten der Lebensbedingungen abzeichnete. Es traten und treten zunehmend tiefe Zweifel an einer solchen „verwissenschaftlichen Technisierung aller Lebensbereiche“ ins Blickfeld der gesellschaftlichen Wahrnehmung.
Zudem kommen in kontroversen, zum Teil auch öffentlichen Diskussionen vielfach Fragen und Forderungen auf, nach der sogenannten,
- objektiven und zweckfreien Forschung, mit
- Forderungen nach einer Orientierung am real-existierenden gesellschaftlichen Bedarf und
- der Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt.
Eingedenk dieser Problematik scheint angesichts der zu Beginn des 21. Jahrhunderts erneut in Erscheinung tretenden:
- sozialen und ökonomischen Probleme,
- in Bezug auf den Klimawandel und ökologisch-ökonomische Herausforderungen sowie
- sich entwickelnder Zivilisationskrankheiten und Pandemiegeschehen,
in einem globalen Maßstab keine Alternativen zur wissenschaftlichen Bewältigung der ungelösten Aufgaben zu existieren.
Die eigentliche Herausforderung zu Beginn des 21. Jahrhunderts liegt daher erkennbar darin, die unterschiedlichen wissenschaftlichen Denk- und Forschungsansätze konstruktiv zusammen zu führen.
Hierfür ist entscheidend, dass Wissenschaften in der Lage sind, wertfrei Erkenntnisse über gesellschaftliche Probleme und ihren Nebenbedingungen zu gewinnen und aufzubereiten, alternative Lösungswege zu artikulieren, ohne jedoch in den Entscheidungskonflikt zu geraten, was letztlich wie umgesetzt wird.
Wissenschaft soll und muss in diesem Sinne wertfrei sein und braucht eine gesellschaftlich getragene Unabhängigkeit, um sich unbelastet irren und korrigieren zu dürfen. Gesellschaftlich bedeutet dies, dass wertfreie Wissenschaft eine Analyse unterschiedlichster Lebensbereiche mit den verschiedensten Perspektiven - ökonomisch, ethisch, technisch, naturwissenschaftlich, theologisch usw. und ihren Lebensorientierungen vornimmt, ohne eine Bewertung abzugeben.
Wissenschaft ist nur dann wertfrei, wenn sie nicht für einen bestimmten Zweck instrumentalisiert wird. („Wertfreiheit“, o. J.; Metzler Lexikon Philosophie)