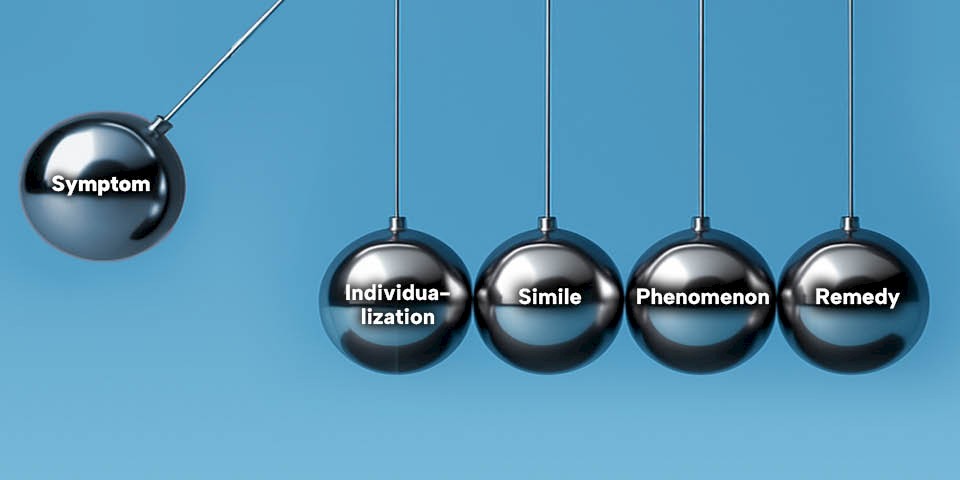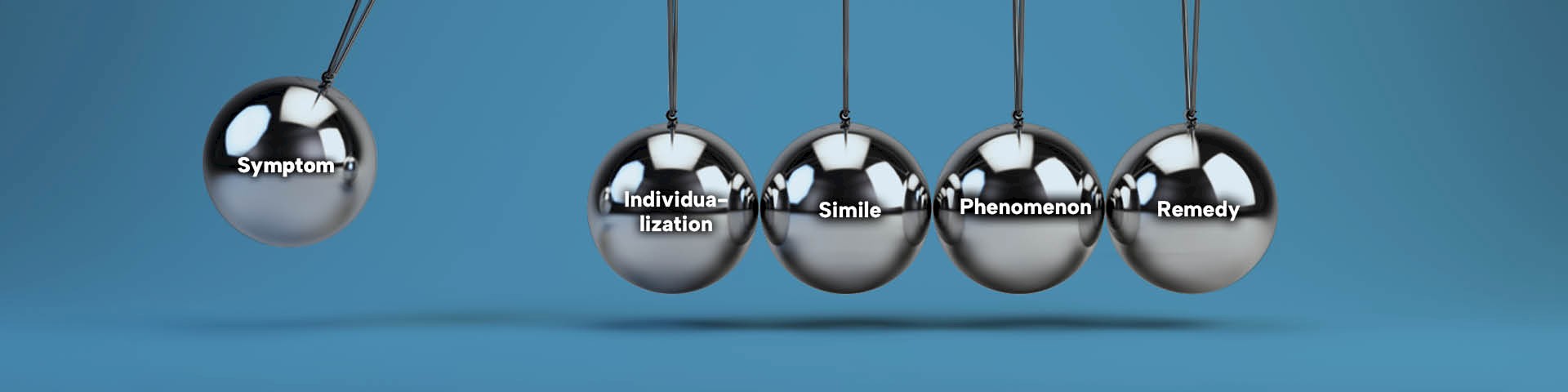Die Prämissen der Homöopathie
Hahnemann beschreibt diese in den Grundzügen gleich zu Beginn in seinem Organon der Heilkunst in den ersten sieben Paragraphen. (Hahnemann, 2017, nach der Ausgabe der 6. Aufl. von Richard Haehl 1921)[1]. Das Organon ist, wie damals in solchen Abhandlungen üblich, in Paragraphen verfasst und folgt, bildlich gesehen, dem Aufbau einer Pyramide. Die ersten Paragraphen bilden die Spitze und definieren die Grundzüge der gesamten Therapie. Die genannten Prämissen in den §§ 1 - 7 werden in den weiteren Abschnitten des Organon systematisch weiter ausgeführt und mit einer ausführlichen praktischen Anleitung versehen. Um einen ersten Eindruck zu erlangen, ist es sinnvoll, diese ersten Paragraphen am Stück zu lesen und epistemologisch zu analysieren.
Organon §1
„Der einzige und höchste Beruf des Arztes ist es, kranke Menschen gesund zu machen, was man heilen nennt.“
Organon §2
„Das höchste Ideal der Heilung ist sanfte, dauerhafte Wiederherstellung der Gesundheit und Hebung und Vernichtung der Krankheit in ihrem ganzen Umfang auf dem kürzesten, zuverlässigen und unnachteiligsten Weg, nach deutlich einzusehenden Gründen.“
Organon §3
„Sieht der Arzt deutlich ein, was an Krankheiten das ist, was an jedem einzelnen Krankheitsfalle insbesondere zu heilen ist (Krankheits-Erkenntnis, Indikation), sieht er deutlich ein, was an den Arzneien, d. h. an jeder Arznei insbesondere, das Heilende ist (Kenntnis der Arzneikräfte), und weiß er nach deutlichen Gründen das Heilende der Arzneien dem was er an dem Kranken unbezweifelbar Krankhaftes erkannt hat, so anzupassen, das Genesung erfolgen muss, anzupassen sowohl in Hinsicht der Angemessenheit der für den Fall nach ihrer Wirkungsart geeignetsten Arznei (Wahl des Heilmittels, Indikation), als auch in Hinsicht der genau erforderlichen Zubereitung und Menge derselben (rechte Gabe) und der gehörigen Wiederholungszeit der Gabe: - kennt er endlich die Hindernisse der Genesung in jedem Falle und weiß sie hinwegzuräumen, damit die Herstellung von Dauer sei: so versteht er zweckmäßig und gründlich zu handeln und ist ein echter Heilkünstler.“
Organon §4
„Er ist zugleich ein Gesundheit-Erhalter, wenn er die Gesundheit störenden und Krankheit erzeugenden und unterhaltenden Dinge kennt und sie von den gesunden Menschen zu entfernen weiß.“
Organon §5
„Als Beihilfe der Heilung dienen dem Arzte die Data der wahrscheinlichsten Veranlassung der akuten Krankheit, so wie die bedeutungsvollsten Momente aus der ganzen Krankheits-Geschichte des langwierigen Siechtums, um dessen Grundursache, die meist auf einem chronischen Miasma[2] beruht, ausfindig zu machen, wobei die erkennbare Leibes-Beschaffenheit des (vorzüglich des langwierig) Kranken, sein gemütlicher und geistiger Charakter, seine Beschäftigungen, seine Lebensweise und (Gewohnheiten, seine bürgerlichen und häuslichen Verhältnisse, sein Alter und seine geschlechtliche Funktion, u.s. w. in Rücksicht zu nehmen sind.“
Organon § 6
„Der vorurteillose Beobachter, - die Nichtigkeit übersinnlicher Ergrübelungen kennend, die sich in der Erfahrung nicht nachweisen lassen, - nimmt, auch wenn er der scharfsinnigste ist, an jeder einzelnen Krankheit nichts, als äußerlich durch die Sinne erkennbare Veränderungen im Befinden des Leibes und der Seele, Krankheitszeichen, Zufälle, Symptome wahr, das ist, Abweichungen vom gesunden, ehemaligen Zustande des jetzt Kranken, die dieser selbst fühlt, die die Umstehenden an ihm wahrnehmen, und die der Arzt an ihm beobachtet. Alle diese wahrnehmbaren Zeichen repräsentieren die Krankheit in ihrem ganzen Umfange, das ist, sie bilden zusammen die wahre und einzig denkbare Gestalt der Krankheit“
Organon § 7
„Da man nun an einer Krankheit, von welcher keine sie offenbar veranlassende oder unterhaltende Ursache (Causa occasionalis) zu entfernen ist sonst nichts wahrnehmen kann, als die Krankheits-Zeichen, so müssen, unter Mithinsicht auf etwaiges Miasm und unter Beachtung der Nebenumstände (§ 5.), es auch einzig die Symptome sein, durch welche die Krankheit die, zu ihrer Hilfe geeignete Arznei fordert und auf dieselbe hinweisen kann - so muss die Gesamtheit ihrer Symptome, dieses nach außen reflektierte Bild des inneren Wesens der Krankheit, d. h. des Leidens der Lebenskraft, das Hauptsächlichste oder Einzige sein, wodurch die Krankheit zu erkennen geben kann, welches Heilmittel sie bedürfe, - das Einzige, was die Wahl des angemessensten Hilfsmittels bestimmen kann - so muss, mit einem Worte, die Gesamtheit der Symptome für den Heilkünstler das Hauptsächlichste, ja Einzige sein, was er an jedem Krankheitsfalle zu erkennen und durch seine Kunst hinweg zunehmen hat, damit die Krankheit geheilt und in Gesundheit verwandelt werde.“